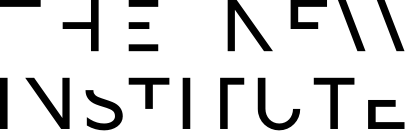
Redefining the Possible
Freiheit
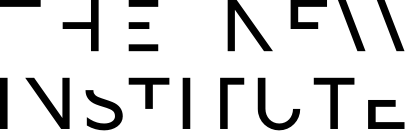
Redefining the Possible
Freiheit
INTERVIEW
Man kann nicht ganz Deutschland mit Eigenheimen zubauen
Viele Menschen fühlen sich nicht frei genug, um auf Konsum zugunsten von Freizeit zu verzichten, sagt der Ökonom Till van Treeck. Muss man Freiheit neu definieren?

Till van Treeck ist Professor für Sozialökonomie und Geschäftsführender Direktor am Institut für Sozioökonomie der Uni Duisburg-Essen. Die Schwerpunkte seiner Forschung und Lehre liegen in den Bereichen der Einkommensverteilung aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive, der deutschen und europäischen Wirtschaftspolitik und der (sozio-)ökonomischen Bildung. Er ist im Vorstand der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft (GSÖBW).
Dieses Interview erschien am 12. Juni 2021 auf ZEIT ONLINE. Das Interview führte die Journalistin Petra Pinzler im Rahmen eines Fellowships am THE NEW INSTITUTE.
Herr van Treeck, im Hamburger Norden sollen bald keine Eigenheime mehr gebaut werden dürfen – um dort die Natur zu schützen. Schränkt das die Freiheit der Menschen unzulässig ein?
Es schränkt sicherlich die Freiheit derer ein, die gern ein Eigenheim bauen wollen. Es erhöht aber die Freiheit derer, die die Fläche und die Materialien vielleicht gern anders verwenden würden – klimaschonender, kreativer, emanzipatorischer. Statt eines privaten Eigenheims könnten auf dem gleichen Platz vielleicht Wohn- und Gartenanlagen für viele Menschen entstehen. Unterm Strich könnte also durch das Verbot die Freiheit eher zunehmen.
Das sehen viele anders. Die Entscheidung wurde vor ein paar Wochen heftig kritisiert, auch Politiker*innen und Ökonom*innen haben über Freiheitsentzug geschimpft.
Es gibt nicht „die“ Ökonom*innen. In den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten ist das Nachdenken über Ökonomie, und damit auch über den Freiheitsbegriff, offener geworden, nicht zuletzt als Ergebnis der weltweiten Finanzkrise ab 2007 und der heute immer offensichtlicheren Klimakrise.
In den Jahrzehnten davor war der Mainstream der Wirtschaftswissenschaften dagegen in einem bestimmten Sinne liberal oder gar libertär geprägt, entsprechend eng war das Verständnis von Freiheit. Und das wirkt bis heute nach. Freiheit wurde da einerseits – wie im Alltag – als Abwesenheit von Zwang begriffen. Andererseits aber war sie eng an das private Eigentumsrecht gekoppelt. Mit seinem Eigentum sollte man tun dürfen, was man will. Von vielen Ökonom*innen wurde deswegen jeglicher „Eingriff“ in das Privateigentum mit der Begrenzung von Freiheit gleichgesetzt. Das aber ignoriert einen wichtigen Teil der Wirklichkeit.
Welchen?
Wenn man Privateigentum – also das Recht an einer Sache – mit Freiheit gleichsetzt, unterschlägt man den Freiheitsentzug derer, die das Recht an dieser Sache nicht haben. Die Freiheit der Eigentümer*innen zählt, die der anderen nicht. Oder um bei Ihrem Beispiel zu bleiben: Die Freiheit derjenigen, die sich ein Eigenheim im Hamburger Norden leisten können, zählt mehr als die der vielen anderen, die vielleicht gern über die Wiese laufen würden.
Na ja, ist das nicht in einer Marktwirtschaft in gewissem Maße immer so, die einen haben etwas und es steht ihnen in gewissen Grenzen frei, damit etwas zu tun, und die anderen dürfen das eben nicht?
Ja, aber man sollte das nicht mit Freiheit verwechseln, denn es stimmt nicht mehr mit dem Wert überein, um den es bei dem Begriff geht. Der politische Philosoph Jerry Cohen hat das klar herausgearbeitet, er nennt diese falsche Verknüpfung „die Inkonsistenz des rechtebasierten Freiheitsbegriffs“: Das Recht an einer Sache wird fälschlich mit der Freiheit gleichgesetzt und die Unfreiheit derjenigen, die davon nichts haben, wird unterschlagen.
Wenn man Privateigentum – also das Recht an einer Sache – mit Freiheit gleichsetzt, unterschlägt man den Freiheitsentzug derer, die das Recht an dieser Sache nicht haben.
Ein „Eigenheim für Alle“ könnte eine Lösung für das Problem sein, oder? Jedenfalls ist das die Politik dieser Bundesregierung, die durch das Baukindergeld und andere Fördertöpfe möglichst vielen Menschen zu einem eigenen Haus oder wenigstens einer Wohnung verhelfen will.
Ja, eine klassische Antwort auf die Inkonsistenz des rechtebasierten Freiheitsbegriffs ist das Wirtschaftswachstum: Wenn beispielsweise die Menschen, die noch kein Haus haben, auch eines haben möchten, müssen wir eben mehr bauen – und so die vermeintliche Freiheit aller erhöhen. Dieses Prinzip stößt aber an Grenzen, wenn es um Güter geht, deren Angebot sich nicht ohne Weiteres ausweiten lässt. Das ist gerade bei Wohnflächen für Einfamilienhäuser in guter Lage und bei intakter Umwelt heute ziemlich offensichtlich. Man kann ja nicht ganz Deutschland mit Eigenheimen zubauen. Wer also eines hat oder baut, nimmt unweigerlich anderen die Freiheit, das auch zu tun. Die Standardökonomik kennt dafür den Begriff der Externalität: Das Handeln der einen hat externe Effekte für andere.
Oder übersetzt: In einer endlichen Welt können nicht immer mehr Menschen in Eigenheimen wohnen.
Ja, allerdings wird die Sache noch etwas komplizierter durch die sogenannten positionalen Güter, wie sie der Ökonom Fred Hirsch in seinem Buch Social Limits to Growth bezeichnet hat. Bei diesen Gütern geht es darum, den eigenen Status in der Gesellschaft zu demonstrieren, da geht es beispielsweise um SUVs.
Verkehrsminister Andreas Scheuer hat kürzlich erst gewarnt, die Grünen wollten den Menschen den SUV wegnehmen. Und wörtlich hat er gesagt: „Da geht es um unsere Freiheit.“
Man könnte zunächst tatsächlich versucht sein zu sagen, es ist Ausdruck von Freiheit, wenn einzelne Leute sich dazu entscheiden dürfen, solche riesigen Autos zu kaufen. Sie wollen die Freiheit haben, ihrem Geschmack zu folgen und sich im Straßenverkehr sicher zu fühlen. Doch selbst wenn man ignoriert, wie sehr diese Autos die Umwelt verschmutzen, wird man zugeben müssen, dass die Teilnahme dieser Autos am Straßenverkehr die Freiheit derer, die kleinere Autos oder Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, reduziert.
Wieso?
Die großen Autos brauchen große Parkplätze, Platz ist aber in Städten begrenzt. Parkende SUVs nehmen also anderen, kleineren Autos den Platz weg. Schlimmer noch aber ist, dass sie den Menschen, die zu Fuß oder per Rad oder Kleinwagen unterwegs sind, die Freiheit nehmen, bei einem Unfall nicht von riesigen panzerartigen Fahrzeugen „abgeschossen“ zu werden.
Viele Ökonom*innen tun sich nach wie vor schwer, über die Statusdimension des Konsumverhaltens, über sogenannte positionale Externalitäten, nachzudenken.
Durch die Besteuerung sollen Unternehmen und Verbraucher*innen dazu gebracht werden, CO2-intensive Produktionsweisen und Konsumstile aufzugeben, aber im Großen und Ganzen soll unsere auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaftsweise unangetastet bleiben.
Sozialdarwinist*innen würden sagen: Sollen die sich doch auch ein großes und damit „sicheres“ Auto kaufen.
Und schon sind wir mitten in einer absurden Aufrüstungsspirale. Es können zwar im Prinzip alle SUV fahren. Hier liegt ein Unterschied zu den Eigenheimen im Grünen, für die es einfach nicht genug Platz gibt. Aber es können nicht alle überdurchschnittlich große Autos fahren! Letztlich ist der SUV ja vor allem dann sicher, wenn er größer und schwerer ist als die Fahrzeuge anderer Verkehrsteilnehmer*innen, wenn also deren Sicherheit geringer ist. Wenn alle so denken, haben am Ende alle größere Autos, es gibt weniger Parkfläche pro Auto und die Sicherheit im Straßenverkehr hat sich nicht oder kaum erhöht. Es gibt etliche Beispiele für Güter, die Gegenstand von positionalem Wettrüsten zulasten des sozialen Friedens und natürlich auch der Umwelt sind.
Dass zu viele SUVs schlecht für die Umwelt sind, ist klar. Aber warum sind sie auch noch schlecht für den sozialen Frieden? Lange Jahre wurde von vielen Ökonomen – und das waren tatsächlich fast ausschließlich Männer – das Gegenteil behauptet. Deren Erzählung ging in etwa so: Jeder Mensch hat die Freiheit, sich anzustrengen, Geld zu verdienen und das dann auch auszugeben, auch für nutzlos schöne Dinge. Der Tellerwäscher kann zum Millionär werden. Und das wiederum ist nicht schädlich, sondern spornt all die anderen eher an, sich auch mehr anzustrengen. So etwas macht eine Gesellschaft dynamisch und innovativ.
Das ist eine sehr verkürzte Sichtweise, denn viele Ökonom*innen tun sich nach wie vor schwer, über die Statusdimension des Konsumverhaltens, über sogenannte positionale Externalitäten, nachzudenken. Andere Wissenschaften wie die Soziologie sind da weiter. Das ist ein Problem, weil damit auch die Folgen ignoriert werden, und die sind drastisch. Denn in ungleichen Gesellschaften passiert Folgendes: Wenn das Einkommen reicher Menschen schneller wächst, können sie sich auch vergleichsweise mehr kaufen. Während einkommensschwächere Menschen dadurch relativ zurückfallen, signalisieren Reiche noch deutlicher ihren sozialen Status. Und es steigen zusätzlich noch ihre Aussichten auf künftigen ökonomischen Erfolg.
Wieso?
Gerade in besonders „freiheitsliebenden“ Ländern wie den USA muss gute Bildung, eine gute Gesundheitsversorgung, gutes Wohnen auf privaten Märkten teuer bezahlt werden: Schon die Wahl des Kindergartens oder der Privatschule fürs Kind ist Teil des Statuskonsums und ermöglicht dem Kind zugleich einen viel besseren Einstieg ins Berufsleben. Wenn die Ungleichheit steigt und die Reichen immer mehr für solche Güter ausgeben, können die Nicht-Reichen das entweder hinnehmen und damit auch ihren sozialen und wirtschaftlichen Abstieg zulassen. Oder sie versuchen, den Reichen nachzueifern, verzichten auf Ersparnisse und Freizeit und arbeiten viel, um bei den gestiegenen Konsumnormen wenigstens ein bisschen mitzuhalten.
Und was hat das nun mit der Klimakrise zu tun?
Bei hoher Einkommensungleichheit gibt es am oberen Ende der Verteilung starke Anreize, sehr viel zu arbeiten, um Karriere zu machen und dadurch weiter zu den Spitzenverdiener*innen zu gehören. Mit diesen Spitzeneinkommen ist ein besonders hoher sozialer Status verbunden, aber eben tendenziell auch ein Konsumstil, der allein aus ökologischen Gründen nicht verallgemeinerbar ist. Wenn die Mittelschicht ebenfalls viel arbeitet, um mit den Konsumnormen der Reichen mitzuhalten, wird immer mehr produziert, also steigen die CO2-Emissionen. Man könnte auch sagen: Da entsteht ein Arbeits- und Wachstumszwang, weil viele Menschen sich nicht frei genug fühlen, auf Konsum zugunsten von Freizeit zu verzichten. Weil sie mithalten wollen und mithalten müssen.
Und was macht das mit den Menschen und der Gesellschaft?
Weil viele Menschen das Gefühl haben, alles zu geben für ihre Karriere und das Wohl ihrer Familien, steigt die Zahl derjenigen, die mit wenig Freizeit, kaum Ersparnissen und hohen Schulden dastehen. Denn es ist in ungleichen Gesellschaften ja definitionsgemäß unmöglich, dass alle oder auch nur viele die beste Bildung erhalten, die sichersten SUVs fahren und in der Einkommenspyramide oben stehen. Bei steigender Ungleichheit wird es immer schwieriger mitzuhalten. Frust und sozialer Unfrieden sind da programmiert.
Seit die Fridays-for-Future-Bewegung den Begriff „Generationengerechtigkeit“ bekannt gemacht hat, bekommt Freiheit auch eine zeitliche Dimension. Es wird über Freiheit und Klimaschutz diskutiert und die Argumentation lautet dann: Wenn wir heute nicht schneller CO2 einsparen, dann gefährden wir die Zukunft und damit die Freiheit der Kinder. Wie diskutieren Ökonom*innen über dieses Problem?
Zunächst einmal muss man festhalten, dass die Klimaziele der meisten Regierungen der reichen Länder inkompatibel sind mit dem Pariser Klimaabkommen, nach dem die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzt werden soll. Wenn man sich an Deutschlands Anteil an der Weltbevölkerung orientiert und auf dieser Grundlage nationale CO2-Budgets vergibt, bleiben Deutschland vielleicht noch maximal sieben Gigatonnen, wenn man sich an den Berechnungen des Weltklimarates (IPCC) orientiert. Bei jährlichen Emissionen von zuletzt circa 800 Megatonnen können wir noch neun Jahre so weiter machen, bis unser Budget aufgebraucht ist. Wenn wir sofort anfangen, die Emissionen linear abzusenken, müsste Klimaneutralität Mitte/Ende der 2030er Jahre erreicht werden. Die Bundesregierung will sich aber bis 2050 Zeit lassen. Fridays for Future und Klimaforscher*innen weisen darauf hin. Mich überrascht oft, wie wenig Ökonom*innen ambitioniertere Ziele einfordern.
Die bisher beliebteste Lösung der Ökonom*innen für die Klimakrise: der CO2-Preis. Wo ist das Problem?
Es gibt, grob gesagt, zwei Wege, die CO2-Emissionen zu senken: sauberer produzieren oder weniger produzieren. Der CO2-Preis soll den ersten Weg ermöglichen. Durch die Besteuerung sollen Unternehmen und Verbraucher*innen dazu gebracht werden, CO2-intensive Produktionsweisen und Konsumstile aufzugeben, aber im Großen und Ganzen soll unsere auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaftsweise unangetastet bleiben.
Die Monetarisierung externer Effekte gilt in der Neoklassik als Königsweg – wo ist sie sinnvoll? Was ist daran falsch?
Neben der Bepreisung von CO2 ist es nötig, über ergänzende Bausteine in einer Gesamtstrategie stärker zu diskutieren: beispielsweise Maßnahmen, die kürzere Arbeitszeiten und weniger Individualkonsum attraktiv machen. Die Vorstellung, dass sich mit der CO2-Besteuerung quasi alle Probleme lösen lassen und wir keinen Kulturwandel brauchen, läuft aus meiner Sicht auf einen unverantwortlichen, technischen Machbarkeitsoptimismus, verbunden mit kulturellem Konservatismus, hinaus.
Weiterdenken für nachhaltige Zukunftsgestaltung
Wenn positionales Wettrüsten und Statusorientierung die Freiheitsgrade für viele Menschen zunehmend gefährden:
Wie müssten Nutzenfunktionen in ökonomischen Modellen angepasst werden, um relative Verteilung besser zu berücksichtigen?
Wenn menschliches Wohlergehen immer auch von der Einbettung in die jeweilige Gesellschaft bestimmt ist:
Welcher Freiheitsbegriff kann die Defizite des rechtebasierten Ansatzes korrigieren, insbesondere in einer räumlich und ökologisch begrenzten Welt?
Wenn eine Wirtschaft innerhalb Planetarer Grenzen nicht ohne einen Kulturwandel funktionieren wird und die Sozialwissenschaften bereits mehrere dieser Wandel beobachtet haben:
Wie müssten dann Annahmen über „die“ Menschen in ökonomischen Modellen angepasst werden?
Diese und weitere Fragen wollen wir im Rahmen eines öffentlichen Symposiums am 31. August weiter diskutieren. Wenn Sie teilnehmen möchten oder Anregungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail redefiningthepossible@thenew.institute