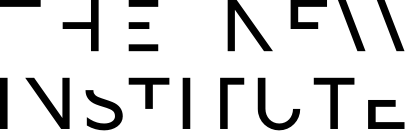
Redefining the Possible
Wettbewerb
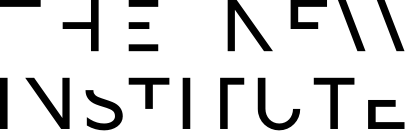
Redefining the Possible
Wettbewerb
INTERVIEW
Wir leben in einer großen, müllproduzierenden Illusion
Der Kapitalismus berücksichtigt die Grundbedürfnisse der Bürger*innen nicht, sagt der Ökonom Dennis Snower. Aber wie kann mit gutem Wettbewerb das Klima geschützt werden?

Dennis J. Snower ist ein US-amerikanisch-deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Präsident der Global Solutions Initiative und Professor für Makroökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance. Er ist ehemaliger Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel sowie Professor für theoretische Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Dieses Interview erschien am 8. Juni 2021 auf ZEIT ONLINE. Das Interview führte die Journalistin Petra Pinzler im Rahmen eines Fellowships am THE NEW INSTITUTE.
Wettbewerb ist gut für die Wirtschaft! Diesen Satz bezweifelt kaum ein*e Ökonom*in. Schon die Studierenden im ersten Semester lernen, wie harter Wettbewerb für die besten Produkte zu den niedrigeren Preisen sorgt. Was ist daran falsch, Herr Snower?
Beim Wettbewerb geht es meistens nicht darum, einfach nur gut zu sein, weil man gut sein will. Es geht um den Vergleich, den Status – also darum besser zu sein als andere. Oft wird der eigene Erfolg am Abstand zwischen mir und den anderen gemessen. Wenn ich mehr Erfolg habe, dann kannst Du nur weniger Erfolg haben.
Also so wie im Sport, wo es in Wettbewerben nicht auf die eigene Bestzeit ankommt, sondern darauf, schneller zu sei als andere. Kann aber Spaß machen, selbst wenn man keine olympischen Erfolge hat.
Tatsächlich ist der Vergleich etwas, was Menschen motiviert. Ich habe lange gemeinsam mit Psycholog*innen und Neurowissenschaftler*innen geforscht, unter anderem mit Tania Singer und dabei gelernt: Das menschliche Gehirn unterliegt verschiedenen Motivationssystemen, eines ist Mitgefühl oder Anteilhabe. Ein anderes ist soziale Zugehörigkeit. Dann haben wir ein selbstbezogenes Begehren, das sich oft in Konsum äußert. Und es gibt eben den Wunsch nach Status. Der ist allerdings oft mit viel Angst verbunden, davor, den Status wieder zu verlieren. Nun belegen viele Studien: Je mehr Wettbewerb es in einer Gesellschaft um den Status gibt, desto mehr nimmt bei vielen Menschen das Wohlbefinden ab.
Warum?
Jeder Mensch hat nur begrenzt Zeit. In der kann er entweder gegen die anderen um Status konkurrieren oder sich mit ihnen zusammentun. Man kann Status eher durch materielle Vergleiche oder digitale Bewertungen – wie Facebook Likes und Twitter Follower – finden als durch zwischenmenschliche Beziehungen. Nun nimmt die Konkurrenz um Status immer mehr zu, weil der technologische Fortschritt die materiellen Vergleiche und die digitalen Bewertungen in den Vordergrund stellt. In sehr statusorientierten Gesellschaften gibt es daher immer weniger Zeit und Räume, in denen sich die Menschen umeinander kümmern, und das mindert das Wohlbefinden.
Doch es passiert noch etwas: Diejenigen, die in bestimmten Bereichen mithalten können, schließen sich in immer kleineren Gruppen zusammen und alle anderen aus. Die Gesellschaft spaltet sich auf, es fallen immer mehr Menschen unten aus dem System heraus, all die, die eben nicht mithalten können. Und die fühlen sich dann zu Recht ausgeschlossen. Was das mit einer Gesellschaft macht, haben wir in den vergangenen Jahren ja in verschiedenen Ländern beobachten können.
Je mehr Wettbewerb es in einer Gesellschaft um den Status gibt, desto mehr nimmt bei vielen Menschen das Wohlbefinden ab.
Eine klassische Antwort darauf ist: Dann muss man für Chancengerechtigkeit sorgen und die Unten besser ausbilden, damit sie auch nach oben kommen können.
Da fehlen zwei Aspekte. Wenn Sie die Unten NUR besser ausbilden, dann verschiebt sich die Skala einfach insgesamt nach oben. Früher war es beispielsweise ganz toll, wenn ein Kind aus einem Arbeiterhaushalt einen Universitätsabschluss hatte. Heute ist das viel normaler, und damit wird der Wettbewerb nur noch härter.
Wir befinden uns also in einer Art Wettlauf, bei der das Tempo langsam vernichtend wird?
Ja. Die Geschichte der Menschheit in den vergangenen dreieinhalb Jahrhunderten kann man so zusammenfassen: Im Mittelalter, vor der industriellen Revolution, waren die sozialen Netzwerke sehr stark, jeder war sehr eingebettet und die meisten waren sehr arm. Dann gab es einen großen technologischen Schub, der hat uns viel ermöglicht, die Menschen sind heute gesünder, reicher und unabhängiger von anderen. Je mehr aber die materiellen Bedürfnisse befriedigt wurden, es genug Essen gab, es in den Wohnungen nicht mehr kalt war und ein funktionierendes Gesundheitssystem entstand, desto selbstverständlicher wurden die materiellen Errungenschaften für das Wohlbefinden des Einzelnen.
Gleichzeitig wuchs der Wunsch nach den immateriellen Teilen des Wohlbefindens, nach Liebe, Anerkennung, Eingebundensein. Nur wissen das viele Menschen nicht. Sie glauben immer noch, ihr Wohlbefinden hängt von ihrem Statuskonsum ab, von der Kreuzfahrt in der Luxuskabine, der Gucci-Uhr. Also produzieren wir immer mehr Güter und Dienstleistungen, die dem Status dienen. Und unterschätzen, wie wichtig die immateriellen Güter sind.
Der Ökonom Binswanger nennt das die „Tretmühle des Glücks“. Ich trete und trete, um nach oben zu kommen und mir etwas leisten zu können. Wenn ich dann aber eine Sache gekauft habe, bleibt das Gefühl über diesen Statuskonsum immer nur kurz. Weil die andere nachziehen. Und weil ich immer länger und härter arbeiten muss, um das Zeug zu kaufen, sinkt mein Glück noch zusätzlich.
Dazu kommt auch noch, dass wir uns an die Dinge gewöhnen. Die müssen also immer größer und toller werden, damit sie noch den gleichen Effekt haben. Gleichzeitig plündern wir den Planeten – für ein Glück, das von kurzer Dauer ist. Ich nenne das „the great wasteful dillusion“ oder auf Deutsch: die große, müllproduzierende Illusion.
Bei allen Umfragen über die Lebenszufriedenheit liegen die sehr ungleichen Vereinigten Staaten ziemlich weit unten. Dänemark schneidet ziemlich gut ab und damit eine Gesellschaft, die relativ gleich ist. Nur, Wettbewerb haben Sie in Dänemark auch.
Jetzt sind wir am entscheidenden Punkt: Es geht nicht darum, diesen Mechanismus abzuschaffen – wir müssen ihn nur neu verstehen und anders regeln. Denn es gibt guten und schlechten Wettbewerb. Guter Wettbewerb ist das, was im Körper nach einer Covid-Impfung passiert. Wenn wir uns infizieren, dann versucht der Körper sich durch viele unterschiedliche Abwehrmechanismen gegen den Virus zu wehren. Eine Impfung beschleunigt diesen Prozess. So ein Verfahren, das vieles ausprobiert, damit die beste Lösung noch schneller gefunden wird – das ist guter Wettbewerb.
Schlechter Wettbewerb ist, wenn am Ende nur ein Produkt herauskommt, das dem einen etwas nützt und vielen anderen arg schadet.
Viele Menschen glauben immer noch, ihr Wohlbefinden hängt von ihrem Statuskonsum ab. Also produzieren wir immer mehr Güter und Dienstleistungen, die dem Status dienen. Und unterschätzen, wie wichtig die immateriellen Güter sind.
Der wirtschaftliche Fortschritt, den die Welt in den letzten 300 Jahren erlebt hat, beruht auf zwei Grundlagen: Zusammenarbeit und Innovation. Ohne Kooperation kann der Mensch sehr wenig erreichen.
Wettbewerb danach zu beurteilen, was er produziert – das klingt theoretisch plausibel, aber praktisch kaum nutzbar. Denn wer soll entscheiden, was guter und was schlechter Wettbewerb ist? Klassische Ökonom*innen würden schlichtweg sagen: Die Menschen haben Präferenzen und nach denen wählen sie aus, was sie wollen und wie sie ihr Geld ausgeben. Und das sorgt dann dafür, dass schon der richtige Wettbewerb um die richtigen Produkte in Gang kommt. Jedenfalls gibt es am Ende etwas, was Menschen kaufen wollen.
Das ist Quatsch. Dann kommt zu oft die Gucci-Uhr raus, die oft mehr Neid als Befriedigung hervorruft.
Wer aber soll das ändern?
Nehmen Sie den Lauf um den besten Wirkstoff gegen Corona. Da haben Regierungen gesagt: Das brauchen wir, also bezahlen wir die nötige Forschung auch vorab. Und plötzlich gab es einen bis dato ungeahnten Wettbewerb, zugleich aber auch Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen, Unternehmen und dem Staat und in sehr kurzer Zeit neue wirksame Impfstoffe. Jetzt geht es nur noch darum, wie die Impfstoffe schnell in großem Maße produziert und verteilt werden. Das ist übrigens nicht nur in diesem Fall so. Der wirtschaftliche Fortschritt, den die Welt in den letzten 300 Jahren erlebt hat, beruht auf zwei Grundlagen: Zusammenarbeit und Innovation. Dabei stellt sich heraus, dass Innovation wiederum in erster Linie durch Zusammenarbeit entsteht. Ohne Kooperation kann der Mensch sehr wenig erreichen.
Aber wie können wir ein politisches System schaffen, dass Kooperation und den guten Wettbewerb fördert und den schlechten behindert?
Guter Wettbewerb sorgt, wie am Beispiel der Impfstoffe beschrieben, für Produkte, die den Grundbedürfnissen des Menschen langfristig dienen. Und die sind nun mal nur zum Teil materieller Art, zum Teil sind es soziale Bedürfnisse, und sie sind eben auch an eine intakte Umwelt geknüpft. Guter Wettbewerb ist Fortschritt in diese Richtungen. Alles andere ist Statusgehabe. Wir müssen also ganz neu unterscheiden: zwischen Gütern und Dienstleistungen, die nur dem Status dienen, und denen, die entweder Grundbedürfnisse befriedigen oder soziale Beziehungen stärken. Das könnte man durchaus tun, aber wie, darüber wollen die meisten Ökonom*innen gar nicht erst reden.
Die meisten Ökonom*innen würden sich tatsächlich schütteln und Sie als Interventionisten beschimpfen, der den freien Markt abschaffen und den Bürger*innen ihre Präferenzen nehmen will.
Ich sage Ihnen, was Interventionismus ist. Den erleben wir doch jeden Tag: Der Staat greift ständig in unser Leben ein, indem er beispielsweise Diebstahl verbietet. Diese Intervention schafft allerdings erst die Voraussetzung für die Marktwirtschaft, denn ohne sie würden sich manche einfach alles nehmen, niemand würde mehr etwas kaufen. Staaten intervenieren überall, ständig, und ohne das gäbe es gar keinen Markt. Marktwirtschaft ist das Produkt unserer Interventionen. Es ist daher Unsinn, von einem freien Markt zu träumen, aus dem sich die Politik ganz heraushält. Das haben sie nur in den sogenannten failed states, also in den Staaten, in denen gestohlen, gemordet werden kann, ohne dass jemand noch einschreitet. Das ist der völlig freie Markt.
Wenn wir was anderes wollen, dann sind wir beim Rechtsstaat, dem sich der Markt anpasst. Wie er das tut, ist von Land zu Land unterschiedlich – weil es unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt.
Nun ist es kaum vorstellbar, dass eine Regierung morgen sagt, wir erlauben nur noch Produkte, die die Grundbedürfnisse befriedigen, und alle anderen nur, wenn sie die Umwelt nicht mehr schädigen.
Das Problem ist tatsächlich, das viele der existierenden Marktwirtschaften auf einem materialistischen Gesellschaftsvertrag beruhen – und dieser berücksichtigt die sozialen Grundbedürfnisse der Bürger*innen nicht. An vielen Orten auf der Welt erleben wir daher, wie sich das Gefühl von Machtlosigkeit und sozialer Entfremdung breit macht – wirtschaftlicher und sozialer Wohlstand sind nicht mehr miteinander im Einklang, sie sind entkoppelt.
Und wie könnten sie das ändern?
Indem sie als einen ersten Schritt die Lebensqualität der Bürger*innen und damit den Erfolg ihrer Politik genauer messen. Eine Lösung dafür stellt Recoupling Dashboard dar, das ich mit Katharina Lima de Miranda entwickelt habe. Das misst immer noch den materiellen Gewinn, aber auch die ökologische Nachhaltigkeit einer Gesellschaft und zwei neue Wohlstandsindizes, nämlich den Grad der gesellschaftlichen Solidarität und der persönlichen Befähigung. Länder, die in diesem Index gut abschneiden, sind auch die, in denen Menschen eine hohe Lebensqualität haben.
Warum sollte das die Politik ändern und den schlechten Wettbewerbsdruck mildern?
Mit diesem Maß würden sie die traditionelle Konfliktlinie zwischen politisch links und politisch konservativ aufbrechen können. Linke Parteien befürworten eine stärkere Umverteilung auf Kosten einer marktwirtschaftlichen Effizienz, während konservative Parteien weniger Umverteilung bevorzugen, um mehr Effizienz zu erzielen. Dabei werden persönliche Befähigung und gesellschaftliche Solidarität als Dimensionen von beiden Seiten weitgehend ignoriert. Das neue Maß würde ganz neue Dimensionen in die politische Debatte bringen. Und das wäre ein erster, großer Schritt.
Weiterdenken für nachhaltige Zukunftsgestaltung
Wenn die Sozialwissenschaften mehrere Motivationssysteme bei Menschen unterscheiden:
Wie kommt es, dass die meisten ökonomischen Modelle sich nur auf eines oder zwei beschränken? Wie lassen sich einflussreiche Modelle transparent darstellen und effektiv erweitern?
Wenn bessere Metriken zur Messung von Fortschritt vorliegen:
Wie kommt es, dass sie keine politische Relevanz entfalten, und wie lässt sich das ändern? Welche bestehenden Prozesse sollten entsprechend neu ausgerichtet werden bzw. welche neuen Evaluationen bräuchte es?
Wenn wir einer großen müllproduzierenden Illusion nachjagen:
Welche Anreize, Standards, Regeln und Abgaben sollten verändert werden, um hier klare Sicht zu schaffen?
Diese und weitere Fragen wollen wir im Rahmen eines öffentlichen Symposiums am 31. August weiter diskutieren. Wenn Sie teilnehmen möchten oder Anregungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail redefiningthepossible@thenew.institute