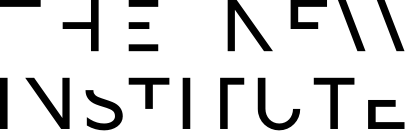
Redefining the Possible
Gerechtigkeit
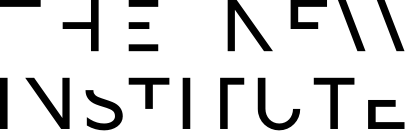
Redefining the Possible
Gerechtigkeit
INTERVIEW
Klimaschutz ist zu sehr ein Projekt der Eliten
Jeder Mensch hat den gleichen Anspruch auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen, sagt Marcel Fratzscher. Aber wie könnte eine gerechte Klimapolitik aussehen?

Marcel Fratzscher leitet seit 1. Februar 2013 das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Davor war er seit 2008 Leiter der Abteilung International Policy Analysis (Internationale wirtschaftspolitische Analysen) bei der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt.
Dieses Interview erschien am 1. Juni 2021 auf ZEIT ONLINE. Das Interview führte die Journalistin Petra Pinzler im Rahmen eines Fellowships am THE NEW INSTITUTE.
Herr Fratzscher, lassen Sie uns den entscheidenden Begriff unseres Gesprächs gleich zu Beginn klären. Sie haben viel darüber geforscht, was Gesellschaften gerechter macht. Trotzdem benutzen Sie häufiger das Wort Gleichheit – warum?
Als Wissenschaftler ist es für mich wichtig, zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven zu unterscheiden. Gerechtigkeit ist subjektiv, jeder kann für sich anders bewerten, was gerecht ist. Gleichheit oder Ungleichheit – das sind hingegen objektivere Begriffe. Man kann objektiv beschreiben, ob beispielsweise Menschen die gleichen Chancen oder Einkommen haben. Da gibt es Fakten und Zahlen und Entwicklungen, die sich messen lassen. Die Ergebnisse dieser Messungen können dann in der politischen oder gesellschaftlichen Diskussion helfen. Und sie sind eine Basis, auf der Menschen entscheiden können, ob sie das Ausmaß an Gleichheit auch gerecht finden. Die Reihenfolge ist wichtig. Erst die Zahlen und Fakten – dann die wertebasierte Diskussion.
Ist es wichtig für den Zusammenhalt von Gesellschaften, dass sie nicht zu ungleich werden?
Sehr ungleiche Gesellschaften haben häufig einen geringen Zusammenhalt. Aber Ungleichheit wird von Bürgerinnen und Bürgern nicht per se als ungerecht empfunden. Die zentrale Frage ist, ob eine Ungleichheit durch freie Entscheidungen der Menschen zustande kommt, oder ob diese fehlende Freiheiten und Chancen widerspiegelt. Wenn also alle Menschen, egal was sie entscheiden, am Ende den gleichen Output, also beispielsweise das gleiche Einkommen haben, führt das nicht zu mehr Zufriedenheit und ist nicht vereinbar mit dem gängigen Verständnis von Gerechtigkeit.
Wenn allerdings der Input, also die Ausgangspositionen der Menschen, so unterschiedlich ist, wie heute bei uns, dann empfinden viele Menschen dies als ungerecht und nicht vereinbar mit unserem Gesellschaftsvertrag. Ein Beispiel dafür ist die fehlende Chancengleichheit bei der Bildung: 74 Prozent der Akademiker*innenkinder gehen zur Uni, 21 Prozent der Nicht-Akademiker*innenkinder. Das ist nicht die Folge einer freien Wahl der Kinder, sondern ist zu einem erheblichen Maße das Resultat einer Ungleichbehandlung und fehlender Chancen. Und dies hat dann Folgen für das ganze weitere Leben, eine schlechte Bildung trägt zu geringerem Einkommen, unzureichender Vorsorge, einer schlechteren Gesundheit und einer geringeren sozialen und politischen Teilhabe bei.
Die entscheidende Frage für eine Gesellschaft ist also, in welchem Maß es Chancengleichheit und Chancenfreiheit gibt. Es geht letztlich um die Grundlage unseres Gesellschaftsvertrags, der sozialen Marktwirtschaft.
Sind gleichere Gesellschaften automatisch auch umweltfreundlichere Gesellschaften?
Das ist häufig so, denn wenn wir als Gesellschaft Chancengleichheit ernst nehmen, dann geht es ja nicht nur um das Hier und Heute, um sie und mich und andere. Wichtig ist dann auch, wie wir Ressourcen und Chancen über Generationen hinweg verteilen wollen. Und wenn wir kommenden Generationen einen intakten Planeten und eine nachhaltige Lebensgrundlage hinterlassen wollen, bedeutet dies, dass wir heute dem Schutz von Umwelt, Klima und Biodiversität sehr viel mehr Bedeutung geben müssen, als wir das zurzeit tun.
Die zentrale Frage ist, ob eine Ungleichheit durch freie Entscheidungen der Menschen zustande kommt, oder ob diese fehlende Freiheiten und Chancen widerspiegelt.
Es wurde in den vergangenen Monaten viel über Generationengerechtigkeit diskutiert, nicht zuletzt durch die Proteste der Fridays-for-Future-Bewegung. Viele junge Protestierende haben das Gefühl, dass wir uns ziemlich wenig um ihre Zukunft scheren – weil wir tot sein werden, wenn es wirklich schlimm wird. Kann man eine Verpflichtung gegenüber der nächsten Generation eigentlich jenseits aller moralischen Fragen auch rational begründen?
Der Naturforscher Pjotr Kropotkin hat argumentiert und Studien haben gezeigt, dass Gesellschaften, die einen hohen Wert auf Solidarität und Gemeinschaftssinn legen, große Krisen und Herausforderungen, wie Kriege, Naturkatastrophen oder eben Pandemien, sehr viel erfolgreicher bewältigen als individualistische und darwinistische Gesellschaften. Solidarität und Gemeinschaftssinn schließen eben nicht nur die eigene Generation, sondern auch die Generationen der Kinder und Enkel mit ein. Eine solche Solidarität ist wichtig, denn sie schafft Vertrauen und Sicherheit, auf die sich Menschen verlassen und damit auch Entscheidungen treffen, die weit über das enge Eigeninteresse hinausgehen. Genau dies ist die Grundlage für unseren Gesellschaftsvertrag, der beinhaltet, dass individuelle Freiheiten und ein gesunder Wettbewerb mit Solidarität und einer guten sozialen Absicherung verbunden werden müssen, um funktionieren zu können.
Warum sollten wir uns an einen Gesellschaftsvertrag gebunden fühlen, den wir nie aktiv unterschrieben haben?
Unser enormer materieller Wohlstand heute existiert, weil Generationen vor uns Entscheidungen getroffen haben, von denen wir heute profitieren. Sie haben in Technologie investiert, für gute Jobs, soziale Sicherheit und Frieden gesorgt, und sie haben mit der Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft eine Gesellschaftsform entwickelt, die die Basis unseres Wohlstands ist. Wenn wir heute diese Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen genauso ernst nehmen, wie die Nachkriegsgeneration unserer Eltern und Großeltern dies getan hat, dann müssten wir deutlich mehr tun, um einen intakten Planeten zu übergeben.
Brauchen wir die nächste Generation nicht auch ganz einfach dafür, dass unsere Rente gezahlt wird, und damit die das kann, braucht sie wiederum eine einigermaßen intakte Umwelt. Und könnte man nicht schlicht daraus folgern, dass gute Umweltpolitik auch eine gute Sozialpolitik ist – weil sie am Ende allen Generationen nützt?
Dies ist sicherlich Teil des Generationenvertrags. Aber ich glaube, man muss noch einen Schritt zurückgehen und noch grundsätzlicher fragen: Wem schulden wir überhaupt Solidarität?
Wir haben doch inzwischen gemerkt, dass wir in einer globalen Welt leben. Keiner der großen Herausforderungen heute, weder die Klimakrise noch die Pandemien, lassen sich national lösen, sie stoppen nicht an Grenzen. Es kann uns also nicht egal sein, was Menschen beispielsweise in Asien machen. Heute leben aber zwei Drittel der Weltbevölkerung dort, fast 40 Prozent in China und Indien. Klimaschutz hilft auch ihnen, er hilft noch mehr den Ländern in Afrika, die am ärmsten dran sind und in jenen Ländern wiederum den Allerärmsten. Die treffen die Dürren und die Überschwemmungen als erstes, also schulden wir ihnen Solidarität. Dies gilt umso mehr, da fast die gesamten Umwelt- und Klimaschäden auf das Verhalten der reichen Länder, gerade auch Deutschland, zurückzuführen sind. Aber auch innerhalb unserer Gesellschaft in Deutschland sind die Schwächsten am stärksten von einer zerstörten Umwelt betroffen, weil sie am wenigsten Möglichkeiten haben, sich zu schützen.
Das klingt theoretisch richtig, aber lassen Sie uns das an einem Beispiel diskutieren: Arme Menschen leben auch in Deutschland eher in den Straßen mit hoher Luftverschmutzung – ihnen würde es sehr nützen, wenn nur noch abgasfreie Autos fahren dürften. Gleichzeitig können sie sich viel weniger als reiche Menschen moderne E-Autos leisten. Würden morgen die Verbrenner verboten, wäre das zwar gut fürs Klima, aber es verlören eine Menge Automobilarbeiter*innen ihre Jobs. Wie lösen wir dieses Dilemma?
Ja, Klima- und Umweltschutz sind auch hierzulande zu sehr ein Projekt der Eliten, welches zu viele Menschen nicht mitnimmt. Es muss ehrlich eingestanden werden, dass die verletzlichsten Menschen die größten Veränderungen hinnehmen müssen, entweder durch die Klimakrise oder auch durch die Veränderungen, die in der Wirtschaft nötig sein werden. Aber ihr Argument enthält einen grundlegenden Widerspruch, denn es suggeriert, Schutz von Klima und Umwelt seien schädlich für wirtschaftlichen Wohlstand und Erfolg. Das ist falsch, das Gegenteil ist der Fall. Es sind Klimakatastrophen, die Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen zerstören. Ein entschiedenes Handeln heute bei der Klima- und Umweltpolitik dagegen sichert Wohlstand und gute Arbeitsplätze.
Es muss ehrlich eingestanden werden, dass die verletzlichsten Menschen die größten Veränderungen hinnehmen müssen, entweder durch die Klimakrise oder auch durch die Veränderungen, die in der Wirtschaft nötig sein werden.
Glück und Lebenszufriedenheit lassen sich nur schwer quantifizieren. Genau deswegen ist die sogenannte Postwachstumsdebatte richtig.
Die verbliebenen Kohlekumpel erleben das gerade, deren Jobs gehen durch den Ausstieg aus der Kohle verloren.
Ja, die Transformation betrifft die Kohlearbeiter*innen und deswegen hilft die Gesellschaft ihnen ja auch massiv finanziell. Aber die Transformation in Deutschland ist ja nur ein Teil des Problems. Viel härter trifft der Wandel viele Millionen Menschen in armen Ländern. In Indien nutzen beispielsweise Millionen Menschen alte Kohleöfen, um es im Winter warm zu haben oder um ihr Essen zu kochen. Wenn sie denen einfach sagen, ihr könnt nicht mehr mit Kohleöfen heizen und die Kohlekraftwerke müssen auch abgestellt werden, dann wird das Leben für sie erstmal sehr viel teurer, für viele wahrscheinlich unbezahlbar.
Man kann es vielleicht noch schaffen, dass eine Mehrheit der Bürger*innen die Milliardenhilfen für die Betroffenen des Kohleausstiegs richtig findet. Aber wie weit reicht die internationale Solidarität in der Realität? Wir fühlen uns den Armen im eigenen Land verpflichtet und sind in Ansätzen noch solidarisch mit anderen Europäer*innen. Bei fernen armen Ländern ist unser Gefühl von Verbundenheit und Verpflichtung eindeutig viel geringer.
Deswegen dürfen wir nicht vergessen, wer für die jetzige Situation beim Klimawandel verantwortlich ist. Beispielsweise beim CO2 in der Atmosphäre: Da sind es zu fast 90 Prozent die reichen europäischen Länder und die USA. Das ist nicht Indien. Wir haben die Klimakrise überproportional stark zu verantworten. Die Vergangenheit verpflichtet uns also, den armen Ländern Technologien zur Verfügung zu stellen, die ihnen bei der Transformation helfen. Am besten, indem wir ihnen dabei helfen, die erneuerbaren Energien auszubauen. Und wir brauchen massive finanzielle Transfers von den reichen Ländern hin zu den armen Ländern – im Pariser Klimavertrag steckt dieser Gedanke bereits drin.
Dem Pariser Klimaabkommen liegt ja auch eine ganz besondere Idee von Gerechtigkeit zugrunde. Jedes Land, jeder Mensch hat danach das gleiche Recht, die gleiche Menge der Atmosphäre zu benutzen, jeder sollte also nur eine bestimmte Menge an CO2 emittieren – nur so viel, dass die Temperaturen am besten nicht um mehr als 1,5 Grad steigen. Was halten Sie davon?
Diese Idee, dass jeder Mensch im Prinzip den gleichen Anspruch auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen hat, finde ich ein überzeugendes Konzept. Und es macht zudem Sinn, dass man es den Menschen ermöglicht einen Ausgleich dieser Ansprüche zu verhandeln. Dies ist die Idee hinter dem Handel von CO2-Zertifikaten, bei dem ein funktionierender Markt einen wichtigen Beitrag leisten kann, indem er über Preise den Verbrauch von CO2 möglichst effizient lenkt – in Bezug auf Klima und Wohlstand.
Ein globaler Markt für CO2-Rechte ist im Moment aber bestenfalls eine Utopie. In der Realität tragen reiche Länder und vermögende Menschen überproportional zur Klimakrise bei und nicht etwa zur Lösung des Problems. Nähme man den Gerechtigkeitsappell des Pariser Klimaabkommens wirklich ernst, dann wäre im Jahr gerade noch ein CO2-Ausstoß von zwei Tonnen pro Kopf vertretbar. Nur zum Vergleich: Ein Flug nach New York verursacht schon fünf Tonnen. Um auf diese Menge zu kommen, können die Armen in Indien noch lange mit Kohle kochen. Ist Klimagerechtigkeit also am Ende nur eine nette Idee?
Ja und es zeigt, dass wir noch meilenweit von einer Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens entfernt sind. Und dass wir vor allem auch in Deutschland und Europa unsere Verpflichtungen, die wir damals eingegangen sind, noch bei weitem nicht erfüllen. Erstens müssen wir in den reichen Ländern unseren CO2-Ausstoß drastisch senken, also uns klimafreundlicher verhalten. Es ist unvermeidbar, dass es für einige Unternehmen und Menschen schwerer ist, die notwendigen Einsparungen vorzunehmen, als für andere. Einen Ausgleich, also eine Umverteilung, von Nutzungsrechten zu schaffen, ist sinnvoll, denn es erleichtert die Anpassung und verbessert damit die Erfolgschancen des Pariser Abkommens.
Irgendjemand wird das bezahlen müssen, irgendwo. Was sagen Sie beispielsweise der Polizistin, die zwar gern CO2 einsparen und ein E-Auto kaufen würde, die aber im Gegensatz zur gutverdienenden Anwältin dafür kein Geld hat – und die sich, wenn die CO2-Emissionen viel teurer werden, auch ihren Diesel bei zu hohen Spritpreisen nicht mehr leisten kann?
Der würde ich sagen: Ja, auf absehbare Zeit können Sie das alte Auto nicht mehr nutzen – aber die Gesellschaft hilft ihnen auch finanziell auf klimaneutrale Alternativen umzusteigen und die stärksten Schultern in der Gesellschaft tragen die größte Last der Anpassung.
Es gibt eine große Debatte darüber, ob es wirklich ein Verzicht ist, wenn der materielle Lebensstandard nicht mehr wächst. Denn es ist ja mittlerweile oft belegt, dass die Lebensqualität ab einem gewissen Einkommensniveau durch noch mehr Geld nicht mehr steigt. Dann werden andere Fragen wichtiger. Wenn das aber so ist, müssten Ökonom*innen dann nicht viel stärker über andere Definitionen von Wohlstand nachdenken?
Es ist tatsächlich ein blinder Fleck der Wirtschaftswissenschaften, dass wir gern alles in Geld fassen wollen. Glück und Lebenszufriedenheit lassen sich nur schwer quantifizieren. Genau deswegen ist die sogenannte Postwachstumsdebatte richtig. Denn die beschäftigt sich genau damit, ob wir nicht statt des Wirtschaftswachstums, gemessen als Bruttoinlandsprodukt, einen anderen Maßstab für den Wohlstand eines Landes brauchen. Das BIP ist kein guter Indikator, um politische Entscheidungen daran auszurichten, es sollte um Wohlstand, Wohlergehen, Zufriedenheit, Glück, Gesundheit, Sicherheit gehen. Und um soziale Teilhabe, Chancen und eine intakte Umwelt für alle. Wir brauchen in diesem Sinne der Chancen und Freiheiten ein höheres Maß an Gleichheit, als es heute existiert.
Ökonom*innen, die das sagen, geraten schnell unter den Verdacht, „linke“ Themen zu bespielen.
Es stimmt, die Frage, ob eine Gesellschaft ungleich ist, galt in den Wirtschaftswissenschaften in Deutschland lange als irrelevant oder links. Hier haben in der Vergangenheit die Ordoliberalen die Debatte dominiert. Das hat sich geändert, aber es fällt immer noch schnell das Wort von der angeblichen Neiddebatte, wenn ich zeige, wo die Ungleichheit zugenommen hat. Da ist man uns im angelsächsischen Raum gut 20 Jahre voraus.
Lesen Sie mal Thomas Piketty, Emmanuel Saez oder auch den Nobelpreisträger Joe Stiglitz zum Thema Ungleichheit. Die leiten aus ihren Forschungen Empfehlungen für die Politik ab, die hierzulande lange auf breite Ablehnung gestoßen sind. Sie wollen die Steuern für Menschen mit mittleren Einkommen reduzieren und dafür Vermögen besteuern, sie wollen bessere Bildungschancen schaffen und unterstützen Mindestlöhne von 15 Dollar. Dieses Denken ist in den USA und den meisten Ländern Europas im wissenschaftlichen Mainstream angekommen, jedoch noch nicht bei uns in Deutschland.
Weiterdenken für nachhaltige Zukunftsgestaltung
Wenn solidarischere Gesellschaften krisenresistenter sind und im Zweifel auch Verteilungsfragen bei Ressourcen erfolgreicher adressieren:
Wie kann eine Definition von Resilienz aussehen, die diese ganzheitliche und auch zukunftsorientierte Sicht fasst? Welche Fakten sollten dafür erhoben und richtungsweisend in politische wie wirtschaftliche Entscheidungsprozesse eingebunden werden?
Wenn wir ehrlich bilanzieren wollen, wie sich wirtschaftlicher Erfolg und struktureller Wandel für die Vermeidung von Klimakatastrophen zueinander verhalten:
Welche Kosten-Nutzen-Modelle bieten hier die überzeugendsten Aussagen und mit welchen Fakten über die Schadschöpfung der aktuellen wirtschaftlichen Praxis sollten sie starten? Wie können die von Ökonom*innen getroffenen Gleichheitsbewertungen in den einflussreichsten Modellen gesellschaftlich transparent diskutiert und gegebenenfalls angepasst werden?
Wenn Gerechtigkeit im Klimawandel bedeutet, dass vergangene Emissionen mitberücksichtigt werden und das Verursacherprinzip greift, wonach die heute reichsten Schultern meist auch die höchsten CO2-Lebenszeitemissionen tragen:
Wie kann die Verbindung von hohem ökologischem Fußabdruck und einer Verantwortung für die dadurch entstehenden Schäden konsequent in politische und ökonomische Instrumente gegossen werden?
Diese und weitere Fragen wollen wir im Rahmen eines öffentlichen Symposiums am 31. August weiter diskutieren. Wenn Sie teilnehmen möchten oder Anregungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail redefiningthepossible@thenew.institute