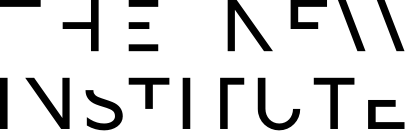
Redefining the Possible
Schulden
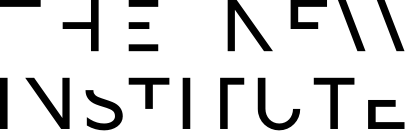
Redefining the Possible
Schulden
INTERVIEW
Eine grüne Null ist
viel wichtiger
als eine schwarze
Wer die Klimakrise lösen will, muss mehr Schulden machen, sagt der Ökonom Jens Südekum. Aber wie bekommt man die Politik dazu, nachhaltig und langfristig zu handeln?

Jens Südekum ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Daneben ist er Research Fellow beim Centre for Economic Policy Research (CEPR), dem CESifo Institut, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und beim Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA).
Dieses Interview erschien am 18. Mai 2021 auf ZEIT ONLINE. Das Interview führte die Journalistin Petra Pinzler im Rahmen eines Fellowships am THE NEW INSTITUTE.
Herr Südekum, sind Schulden gut oder schlecht für die Umwelt?
Allen ist heute klar, dass jede Tonne CO2, die noch emittiert wird, die Klimakrise weiter verschärft. Das schadet den kommenden Generationen erheblich. Spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das explizit die Freiheitsrechte kommender Generationen betont, herrscht doch Einigkeit darüber, dass wir möglichst schnell Klimaneutralität erreichen müssen. Wenn ein Staat dieses Ziel besser erreichen kann, indem er Schulden macht, muss er das tun. Klimaneutralität ist das übergeordnete Ziel.
Staatsverschuldung als logische Konsequenz aus der Klimakrise – der Satz widerspricht fundamental der deutschen Gesetzgebung, jedenfalls der bisherigen. Die Schuldenbremse verlangt, dass die Regierung dauerhaft nicht mehr Geld ausgibt als sie einnimmt.
Damit ist die Schuldenbremse eben auch ein Symbol dafür, dass wir die Herausforderungen der Zukunft wie den Klimawandel nicht so ernst nehmen. Eine Grüne Null – also die Rückführung der Treibhausgas-Emissionen – ist viel wichtiger als eine schwarze Null.
Sie unterstellen damit, dass mehr Schulden automatisch zu einer besseren Klimabilanz führen. Sie könnten aber auch nur zu mehr Schulden und trotzdem mehr CO2-Emissionen führen. Gibt es historische Belege dafür, dass Ihr Zusammenhang funktioniert?
Nein, die gibt es nicht. Deshalb sorgen sich ja auch manche Politiker*innen und Ökonom*innen, dass mehr staatliche Schulden dem Land am Ende gar nichts bringen, weil das Geld nicht effektiv eingesetzt wird. So nach dem Motto: Wenn die Büchse der Pandora erst mal auf ist, dann schmeißen die Politiker*innen das Geld für alles Mögliche raus.
Und, ist das so falsch?
Die Gefahr besteht schon, dass zusätzliche staatliche Mittel auch für Lobbypolitik, Rentenerhöhungen oder für was auch immer ausgegeben werden. In den USA, wo man keine große Angst vor Schulden hat, floss das Geld in der Vergangenheit zum Beispiel oft ins Militär. Donald Trump hat Schulden gemacht, um die Steuern für Reiche zu senken. Es gibt aber kein Naturgesetz, dass sich das immer wiederholen muss. Es geht auch anders. Der neue US-Präsident Joe Biden will über eine Billion Dollar explizit in den Green Deal stecken, um zielgerichtet den Klimaschutz zu finanzieren. Das halte ich für einen sinnvollen Ansatz.
Das Land, das als Erstes die Klima- und Ressourcenneutralität erreicht, hat seine wirtschaftliche Basis auf den Weltmärkten für Jahrzehnte gesichert.
Weil in Zukunft alles anders sein wird und Politiker*innen wie Joe Biden vorausschauender, altruistischer und klüger sind?
Nein, weil wir jetzt in einer neuen Lage sind. In der Klimafrage ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem in fast allen Ländern klar wird: So wie bisher geht es nicht weiter. In den vergangenen 30 Jahren haben wir uns doch weltweit immer nur gegenseitig den Schwarzen Peter zugespielt. Viele haben sich gedacht, wenn das eigene Land mehr Klimaschutz betreibt, dann schadet uns das bloß, weil die anderen nicht mitziehen und dann Wettbewerbsvorteile einsammeln. Und mit dieser Entschuldigung haben dann alle zu wenig getan und das Problem vertagt.
Mittlerweile haben aber viele verstanden, dass wir umsteuern müssen, und da wird die Entwicklung und Anwendung grüner Technologien plötzlich zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor. Das Land, das als Erstes die Klima- und Ressourcenneutralität erreicht, hat seine wirtschaftliche Basis auf den Weltmärkten für Jahrzehnte gesichert. Und bei diesem Wettlauf spielen staatliche Ausgabenprogramme zur Beschleunigung der Transformation eben eine wichtige Rolle. Die entscheidende Frage ist: Wie kann man sicherstellen, dass ein Staat, der Schulden macht, dieses Geld auch sinnvoll ausgibt? Hier ist politische Führung gefragt.
In Deutschland kämpft die CDU für die Schuldenbremse und konservative oder liberale Politiker*innen finden, dass eine solide Regierung nur so viel Geld ausgibt, wie durch Steuern reinkommt. Sind rechte Politiker*innen gegen Schulden und linke dafür?
Also global gesehen eher nicht. In den USA hat einst der Republikaner Ronald Reagan massiv Schulden gemacht und zuletzt, wie gesagt, auch Donald Trump. Der Demokrat Bill Clinton reduzierte wiederum die Haushaltsdefizite, genauso wie Barack Obama nach der Finanzkrise. Die Sache hat in den USA wenig mit rechts oder links zu tun, in vielen anderen Ländern übrigens auch nicht.
Deutschland ist ein spezieller Fall. Hier dominierte bisher in vielen Parteien die Meinung, man müsse dem Staat grundsätzlich misstrauen. Politiker*innen unterstellte man, dass sie mit schuldenfinanziertem Geld bloß Geschenke für ihre Freund*innen und Wähler*innen bezahlen wollen. Deswegen dürfe man ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben. Natürlich sind diese Befürchtungen nicht ganz falsch. Aber man darf sie eben auch nicht verabsolutieren. Denn das führt ins andere Extrem: eine Verteuflung von Schulden, selbst dann, wenn sie ökonomisch sinnvoll sind.
Hierzulande bestimmt noch ein weiterer Faktor die Diskussion, die moralische Aufladung: Bei „jemandem in der Schuld stehen“ ist etwas Verwerfliches, etwas, das man schon den Kindern als ungehörig beibringt und lieber vermeiden sollte. Schuldner*innen haben einen schlechteren Leumund als Gläubiger*innen.
Da sagt die Sprache tatsächlich viel über kulturelle Unterschiede: Schuld und Schulden sind hier der gleiche Begriff. Im Englischen unterscheidet man zwischen „debt“ (Anm. d. Red: finanzielle Verschuldung) und „guilt“ (Anm. d. Red.: moralische Schuld) und kann damit gedanklich und gefühlt klarer unterscheiden.
Aber um nicht falsch verstanden zu werden: Ich möchte auch nicht, dass unbekümmert Schulden für alles Mögliche gemacht werden, beispielsweise um die nächste Mütterrente zu bezahlen. Man muss die Regeln so gestalten, dass Verschuldung nur dann erlaubt ist, wenn es explizit der nächsten Generation nützt.
Kennen Sie ein Land, eine Regierung, wo die Verschuldung ausschließlich oder vorwiegend für die Bedürfnisse der kommenden Generationen verwendet wurde?
In den USA war das etwa beim New Deal von Präsident Roosevelt in den 1930er Jahren der Fall. Aber es gibt wie gesagt auch aktuellere Beispiele. Der jetzige US-Präsident Biden will in den kommenden zehn Jahren insgesamt zwei Billionen Dollar investieren – für Infrastruktur, Forschung und Klimaschutz. Das ist für die ganze Welt erstmal eine gute Nachricht, denn der Plan wird vermutlich viele neue grüne Technologien hervorbringen. Europa darf dem nicht bloß ehrfürchtig zusehen. Denn sonst werden wir noch weitere moderne Geschäftsmodelle an die USA verlieren, gerade im Bereich der Industrie. Wir müssen uns anstrengen und ein vergleichbares Programm auf den Weg bringen.
Da sagt die Sprache tatsächlich viel über kulturelle Unterschiede: Schuld und Schulden sind hier der gleiche Begriff.
Was brauchen wir als Gesellschaft, um die Klimakrise zu verhindern? Welche Infrastruktur muss erneuert, welche ganz neu gebaut werden?
So wie es neuerdings passiert? Seit Beginn der Corona-Krise erfinden Finanzministerien weltweit immer neue schuldenfinanzierte Programme, und die sollen oft auch die grüne Transformation der Wirtschaft beschleunigen. Ist das die Politik, die Sie sich wünschen?
Im Grunde schon. Aber man muss zwischen Konjunkturpolitik und Transformationspolitik trennen. In der Corona-Krise, als die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal um zehn Prozent einbrach, musste schnell etwas passieren. Also legte die Regierung große Ausgabenprogramme auf. In denen fand sich beispielsweise der Familienbonus, wo jede einkommensschwache Familie 400 Euro bekam. Das war gut so. In so einer speziellen Situation geht es ums Tempo. Aber der klimaneutrale und digitale Umbau der Wirtschaft hat nichts mit Konjunktur zu tun. Er ist völlig unabhängig davon notwendig, um die Volkswirtschaft mittel- bis langfristig auf einem guten Kurs zu halten.
Aber auch dafür braucht es staatliche Gelder...
Klar, aber diese Transformation hängt nicht nur an staatlichem Geld. Erstmal müssen die richtigen Rahmenbedingungen für private Investitionen gesetzt werden, etwa durch ambitionierte CO2-Steuern oder ein verschlanktes Planungsrecht. Aber die Wirtschaft muss sich auch darauf verlassen können, dass der Staat in den kommenden 20 Jahren kontinuierlich einen großen Betrag in moderne Infrastruktur investiert und die Unternehmen bei ihrer Transformation gezielt unterstützt. Nur dann werden sie die nötigen Kapazitäten aufbauen und ihre eigenen Investitionen entsprechend ausrichten. Das alles wird sehr viel Geld kosten. Aber hier legen wir uns mit unseren restriktiven Fiskalregeln selber Steine in den Weg.
Wie stellen Sie sich das praktisch vor, was sollten die Regierung und der Bundestag tun?
Wir sollten die deutsche Schuldenbremse und den europäischen Stabilitätspakt grundlegend reformieren. Beide passen nicht mehr zu den aktuellen Herausforderungen. Sie erlauben zwar Schulden in einer akuten Konjunkturkrise, wie jetzt bei Corona. Aber nicht für die langfristige Finanzierung der Transformation. Gewissermaßen ignorieren diese Schuldenregeln also die Klimakrise. Denn es wird nicht gefragt, wofür eigentlich Geld gebraucht wird. Es ist egal, ob der Finanzminister damit grüne Stahlproduktion fördern, oder ob er das Geld einfach zum Fenster rausschmeißen will. Aus Sicht der Schuldenbremse ist beides gleichermaßen verboten. Das muss sich ändern und da waren wir in der Vergangenheit schon mal klüger.
Wann war das?
Bevor die Schuldenbremse ins Grundgesetz kam, also vor 2009, gab es die sogenannte „goldene Regel“, den alten Artikel 115 des Grundgesetzes. Der erlaubt grundsätzlich eine Neuverschuldung in Höhe der Investitionen, und das halte ich auch grundsätzlich für vernünftig. Kluge moderne Gesetze würden daran anknüpfen, zugleich aber unter modernen Kriterien berücksichtigen, was heutzutage als Investition gelten muss.
Müssen wir nicht, bevor wir über diese riesigen, neuen Schulden reden, über die Ausgaben streiten? Was sind in Zeiten der Klimakrise noch ökologisch und sozial vertretbare Investitionen?
Im Moment krankt die Debatte tatsächlich daran, dass sich alle darüber streiten, ob wir mehr Schulden machen dürfen und wenn ja, wie viele. Wir sollten stattdessen besser fragen: Was brauchen wir als Gesellschaft, um die Klimakrise zu verhindern? Welche Infrastruktur muss erneuert, welche ganz neu gebaut werden? Und in dem Zuge müssen wir auch den Begriff der staatlichen Investitionen aktualisieren. Es sollte nicht plötzlich alles als Investition gelten, bloß um die Schuldenfinanzierung zu ermöglichen. Aber wir dürfen auch nicht einfach an den veralteten Konzepten festhalten. Dann umfassen Investitionen nämlich oft bloß Straßen und Gebäude, während zum Beispiel die Gehälter von Lehrer*innen oder Wissenschaftler*innen als Staatskonsum gelten.
Wie würden Sie staatliche Investitionen neu definieren?
Eine moderne Definition muss vor allem das Humankapital umfassen, also Investitionen in Bildung und Forschung. Diese Debatte um die Abgrenzung des Investitionsbegriffs wird natürlich kompliziert. Aber die Menschheit hat schon schwierigere Probleme gelöst.
Am Ende der Debatte sollte dann eine halbwegs belastbare Zahl rauskommen und dann sollten wir überlegen, wie die finanziert werden kann. Und dabei würde dann klugerweise auch die Neuverschuldung eine Rolle spielen. Außerdem muss man natürlich berücksichtigen, was die Schulden den Staat eigentlich kosten. Denn es macht einen Unterschied, ob er für seine Schulden fünf Prozent Zinsen zahlen muss, wie in den frühen 2000er Jahren, oder ob die Zinsen wie momentan bei minus 0,5 Prozent liegen. Derzeit bekommt der Bund ja für jeden geliehenen Euro einige Cent von den Anleger*innen geschenkt.
Wie wichtig die Höhe der Zinsen ist, wissen alle, die schon mal eine Wohnung gekauft oder ein Haus gebaut haben. Klar ist aber auch: Schulden müssen irgendwann mal zurückgezahlt werden. Sie aber argumentieren, diese Regel gelte zwar für Privatleute aber nicht für Staaten. Warum ist das so?
Wenn Sie die Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg betrachten, dann haben die USA niemals Staatsschulden zurückgezahlt, und auch fast kein anderes großes wichtiges Land. Deutschland hat zwischen 2014 und 2019 tatsächlich getilgt und seinen absoluten Schuldenstand etwas reduziert. Aber das war eine große Ausnahme. In der Regel werden Staatsschulden nicht getilgt.
Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Wo ist der Haken?
Entscheidend sind bei der Staatsverschuldung drei Faktoren: die Zinshöhe, das Wirtschaftswachstum und die Laufzeit der Schulden. Wenn der Bund sich heute 100 Euro für zehn Jahre leiht, dann muss er diese Summe am Ende der Laufzeit natürlich zurückzahlen. Aber er tut das, indem er dann eine neue Anleihe ausgibt. Man nennt das Schuldenüberwälzung: neue Schulden ersetzen alte Schulden.
Damit das funktioniert, kommt es vor allem darauf an, dass in der Zwischenzeit die Wirtschaft und damit die Steuereinnahmen ordentlich gewachsen sind, denn dann fallen die 100 Euro, die da überwälzt werden, ja nicht mehr so stark ins Gewicht. Trotzdem gibt es ein zentrales Risiko: die Zinsentwicklung. Wenn die Zinsen im Zeitablauf steigen, dann wird die Überwälzung immer teurer und es droht im Extremfall eine Schuldenkrise wie 2012 in Griechenland. Vor allem wenn man auf kurzfristige Anleihen mit Laufzeiten von nur wenigen Monaten setzt, dann besteht nämlich permanent ein hoher Refinanzierungsbedarf und man starrt auf die Finanzmärkte wie ein Kaninchen auf die Schlange.
Wie hoch schätzen Sie die Gefahr?
So weit muss es gar nicht kommen. Die Staaten haben die vergangenen Jahre genutzt, um die durchschnittlichen Laufzeiten deutlich zu verlängern. Das bringt schon mal Ruhe rein. Außerdem versteht die Europäische Zentralbank mittlerweile, dass sie eine Spekulation der Finanzmärkte gegen ein Euro-Mitgliedsland nicht zulassen darf. Und sie hat mit ihren Ankaufprogrammen ja auch gute Instrumente dagegen.
Aber von solchen Extremfällen mal abgesehen, ist es gerade für Deutschland recht unwahrscheinlich, dass die Zinsen auf absehbare Zeit wieder deutlich steigen. Die Zinsen sind nämlich weltweit seit den siebziger Jahren kontinuierlich zurückgegangen und daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Die Gründe ersparen ich Ihnen.
Bitte nicht.
Wir erleben etwas, dass die Ökonom*innen die säkulare Stagnation nennen. Die Inflation ist seit Jahren niedrig, und die Zinsen sind oft sogar negativ. Warum ist das so? Weil weltweit sehr viel gespart wird und gleichzeitig die Unternehmen viel weniger Geld auf dem Kapitalmarkt nachfragen, um es zu investieren. Denn moderne Internetfirmen und Dienstleister haben da strukturell einen geringeren Bedarf als die großen Industriekonzerne der Vergangenheit. Wenn aber die Privatunternehmen die hohen Ersparnisse nicht absorbieren wollen, dann muss es eben der Staat tun. Sonst werden die Zinsen nur immer weiter sinken.
Also müssen die Staaten in die Bresche springen und investieren, weil es die Unternehmen von allein nicht tun?
Ganz genau. Und zu tun gibt es – Stichwort: Klimakrise und Digitalisierung – wahrlich genug. Dabei sollten wir aus Vorsichtsgründen vor allem auf langfristige Anleihen setzen. Am besten mit Laufzeiten 30 oder 50 Jahren. Österreich hat sogar eine 100-jährige Anleihe ausgegeben. Denn sollten in Zukunft die Zinsen doch wieder steigen, dann hätte der Staat genug Vorlauf, um sich darauf vorzubereiten. Außerdem wird das Wirtschaftswachstum über einen so langen Zeitraum dafür sorgen, dass sich die heute aufgenommenen Schulden bis zum Fälligkeitszeitraum real stark entwertet haben.
Sie betonen ja, dass Wirtschaftswachstum wichtig für die Schuldentragfähigkeit ist. Bisher hat mehr Wachstum aber immer zu mehr Umweltverschmutzung geführt. Ihre logische Kette wäre dann: Wir machen Schulden, um das Klima zu retten, und gleichzeitig müssen wir wachsen, um die Schulden zu bezahlen – was wiederum die Klimakrise anheizt. Klingt nach einem Teufelskreis, oder?
Es geht bei der Transformation doch gerade darum, Wirtschaftswachstum von Schadstoffemissionen und Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Europa hat das in der Vergangenheit ja schon viel besser geschafft als zum Beispiel die USA oder China. Aber nochmal: mittlerweile ist doch ein globaler Wettlauf in die Gänge gekommen, wer als erster die Technologien entwickelt, die eine vollständige Entkopplung ermöglichen. Deshalb ist es doch so wichtig, dass Europa endlich beherzt investiert, um hier ganz vorne dabei zu bleiben. Und dann ist auch der besagte Teufelskreis durchbrochen.
Weiterdenken für nachhaltige Zukunftsgestaltung
Wenn wir „Investitionen“ so neu definieren wollen, dass wünschenswerte soziale und ökologische Ziele ermöglicht werden:
Wie können wir diesen Aushandlungsprozess vor der Übernahme durch Partikularinteressen schützen und ihn für ein wachsendes Vertrauen in die Gemeinwohlorientierung des Staates nutzen?
Wenn wir wirtschaftliche Instrumente als historisch veränderliche Mittel zum Zweck verstehen, rückt ihre politische Gestaltung in den Fokus:
Wie können wir diese Perspektive so kommunizieren, dass Innovationsbegeisterung in der Ökonomie und Aufklärung über Wirtschafts- und Finanzpolitik wachsen?
Wenn wir anerkennen, dass die Entkopplung von wirtschaftlichem Wachstum und Umweltverbrauch in der Vergangenheit nicht annähernd ausreichend war und dass wir in den nächsten zehn Jahren die Übernutzung von Ökosystemen nicht nur stoppen, sondern regenerativ umkehren müssen:
Welche Maßnahmen können und sollten zum Einsatz kommen, damit uns das gelingt – und wie messen wir dann Wachstum, nach welchen Kriterien?
Diese und weitere Fragen wollen wir im Rahmen eines öffentlichen Symposiums am 31. August weiter diskutieren. Wenn Sie teilnehmen möchten oder Anregungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail redefiningthepossible@thenew.institute