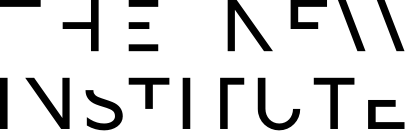
Redefining the Possible
Wachstum
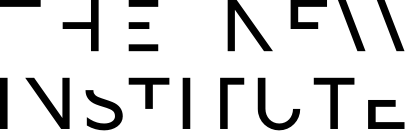
Redefining the Possible
Wachstum
INTERVIEW
Ich sehe keine Grenzen für nachhaltiges Wachstum
Lebensqualität muss künftig ganz anders gemessen werden, fordert der Ökonom Tom Krebs. Aber können wir trotz Klima-Krise einfach endlos immer mehr konsumieren?

Tom Krebs ist Professor für Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Universität Mannheim. Er forscht und lehrt schwerpunktmäßig zu Auswirkungen von Wirtschaftskrisen und Reformen auf Wachstum, Ungleichheit und Lebensqualität der Menschen. Von September 2019 bis Februar 2020 war er Visiting-Professor am Bundesministerium der Finanzen in Berlin.
Dieses Interview erschien am 25. Mai 2021 auf ZEIT ONLINE. Das Interview führte die Journalistin Petra Pinzler im Rahmen eines Fellowships am THE NEW INSTITUTE.
Herr Krebs, ein großer Teil der Ökonom*innen findet Wirtschaftswachstum unverzichtbar. Warum?
Wir alle wünschen uns, dass die Lebensqualität immer weiter zunimmt. Und Ökonom*innen wollen es messen. Weil die Menschen allerdings sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was ihre Lebensqualität ausmacht, nehmen wir Ökonom*innen einen Näherungswert. Wir addieren das, was sich in Marktpreisen messen lässt – also den Zuwachs an Gütern und Dienstleistungen. Daraus ergibt sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Aber natürlich ist das nur ein Äquivalent, bei dem wichtige Informationen fehlen.
Was ist alles nicht drin?
Die Frage, wie Wohlstand verteilt ist und die Wirkung auf die Umwelt. Also beispielsweise die Klimakrise. Wir Ökonom*innen nennen das einen sogenannten externen Effekt: Das bedeutet, dass die Nebenwirkungen des Wirtschaftens, also in diesem Fall der Ausstoß von Klimagasen, nicht in den Preisen der produzierten Güter enthalten sind und damit auch im BIP nicht mitgerechnet werden. Also kann das BIP auch nicht zeigen, wie wir die Umwelt zerstören. Es sagt übrigens auch nichts darüber aus, wie der Wohlstand verteilt ist.
Das Wirtschaftswachstum ist trotz so offensichtlicher Mängel zum entscheidenden Maßstab geworden. Länder, Regionen und sogar Kontinente werden aufgrund ihres BIPs miteinander verglichen. Wie konnte diese Kennzahl so wichtig werden?
Vielleicht, weil sie doch stark mit anderen Dimensionen von Lebensqualität korreliert. In reicheren Gesellschaften mit einer wachsenden Wirtschaft ist die Lebensqualität für viele Menschen deutlich besser als in armen. Das Einkommen der Menschen ist höher und das wiederum bestimmt stark, was sie sich leisten können und was sie für Chancen haben. Man sollte dabei aber, wie gesagt, unbedingt immer im Kopf haben, was das BIP eben NICHT misst.
Ist das Problem nicht viel größer? Das BIP ist doch nicht nur ein Maß, dem wichtige Informationen fehlen – es ist doch sogar eines, das falsche Informationen präsentiert. Nehmen wir die Havarie eines Öltankers: Wenn das auslaufende Öl einen Strand verpestet und danach viel Geld in die Aufräumarbeiten gesteckt werden muss, dann steigt das lokale BIP, weil ja Geld ausgegeben wird und so das Wachstum der lokalen Wirtschaft ankurbelt. Das ist doch verrückt, oder?
Ja und Nein. Denn das Saubermachen der Strände ist ja etwas Nützliches. Aber Sie haben natürlich Recht, der ursprüngliche Schaden, also der verseuchte Strand, wäre im BIP des betroffenen Landes oder der Region nicht enthalten. Und da muss man auch ansetzen, das kritisiert die Umweltbewegung zu Recht. Sie fordert, dass die vielen kleinen und großen Umweltschäden besser gemessen und reflektiert werden. Gesellschaften und Regierungen brauchen daher einen zusätzlichen Indikator für den umweltbezogenen Teil der Lebensqualität. Den sollten sie genauso ernst nehmen wie das BIP.
Gesellschaften und Regierungen brauchen daher einen zusätzlichen Indikator für den umweltbezogenen Teil der Lebensqualität. Den sollten sie genauso ernst nehmen wie das BIP.
Der Indikator soll genau was messen?
Er müsste den ökologischen Fußabdruck eines Landes dokumentieren. Ein wenig geschieht das bereits mit der Messung des CO2-Ausstoßes eines Landes und dem Anstieg der Temperatur. Wir wissen heute, dass zu viel Treibhausgase in der Atmosphäre unsere Lebensqualität dauerhaft massiv beeinträchtigen werden. Der CO2-Ausstoß als Äquivalent für die ökologischen Schäden hätte auch den Vorteil, dass er ein einfach verständliches Maß ist. Noch besser wäre es allerdings, wenn man die Schäden in Euro ausdrücken würde.
Warum gehen Ökonom*innen immer davon aus, dass alles auf der Welt quantifiziert und in Geld umgerechnet werden muss?
Um es vergleichbar zu machen und so eine Basis für Entscheidungen zu haben. Nehmen Sie beispielsweise die Luftverschmutzung. Da kann man die Menschen fragen, wie viel Geld ihnen saubere Luft wert wäre. Solche Experimente gibt es bereits, sie können diese Form von Abstimmung über die Geldbörse auch in der Realität beobachten. In den USA, wo das Einkommen viel stärker bestimmt, wo Sie wohnen können, leben reichere Menschen in den Gegenden mit den besseren Schulen und der sauberen Luft. Das gute Leben gibt es also schon heute und die Menschen sind auch bereit dafür zu zahlen – wenn sie es sich leisten können. Diesen Mechanismus könnte man auch auf andere ökologische Probleme übertragen.
Was machen Sie mit den Umweltproblemen, die die Menschen nicht einschätzen und damit auch richtig bewerten können? Weil sie beispielsweise die Folgen der Klimakrise noch nicht fühlen oder glauben, die kommen erst in ferner Zukunft?
Ökonom*innen würden trotzdem versuchen, den Klimawandel und seine Folgen in Kosten und Verlusten von Lebenseinkommen zukünftiger Generationen umzurechnen. William Nordhaus hat diesen Ansatz verfolgt und dafür sogar den Nobelpreis bekommen. Sie mögen das für verrückt und unsinnig halten, aber wir müssen doch irgendwie eine seriöse Abwägung von Umweltschäden, Wirtschaftswachstum und Lebensqualität hinbekommen. Dafür dürfen wir kein Ziel absolut setzen, sondern müssen Mechanismen schaffen, die uns beim Abwägen und Übersetzen helfen. Das schließt nicht aus, dass das Ergebnis dieser gesellschaftlichen Abwägungen die politische Vorgabe „Klimaneutralität 2050“ ist.
Klingt trotzdem zynisch und setzt voraus, dass man tatsächlich abwägen kann: zwischen Wachstum und Umweltschutz. Dabei ist ohne eine gute Klimapolitik irgendwann auch kein Wachstum mehr möglich.
Noch mal, es geht Ökonom*innen immer um die Erhöhung von Lebensqualität – und die hat nun mal verschiedene Dimensionen. Eine davon ist die Steigerung des Materiellen, gemessen im BIP. Eine weitere die Verteilung von Ressourcen, also die Frage von Ungleichheit – auch da ist das BIP wie gesagt ziemlich blind. Und eine dritte Dimension ist der Umweltschutz. Das bedeutet aber auch: Wenn wir jetzt mehr Umweltschutz betreiben, dann kann das bedeuten, dass wir zulasten eines Teils unserer Lebensqualität – gemessen in materiellem Wohlstand – die Lebensqualität der künftigen Generation erhalten. Es geht in der Ökonomie immer darum, einen Umweltschaden so auszudrücken, dass er mit den materiellen Aspekten der Lebensqualität vergleichbar wird.
Wir wissen durch viele Umfragen, dass die Menschen heute eine hohe Präferenz für Klimaneutralität im Speziellen und für mehr Umweltschutz im Allgemeinen haben. Wir müssen also jetzt noch darüber diskutieren, wie wir den Wandel beschleunigen.
Prinzipiell sehe ich keine Grenzen für ökologisch nachhaltiges Wachstum, solange wir weiterhin erfinderisch bleiben.
Ökonom*innen würden also auch das Artensterben in Preise umrechnen und den Bienen einen Preis geben, damit wir dann entscheiden können, ob wir uns die noch leisten wollen oder ob uns deren Erhaltung zu teuer ist?
Ja, man kann und sollte berechnen, wie teuer es wäre, einen Teil der Welt zu vernichten. Und auch, was es kosten würde, in einem anderen Teil der Welt wieder eine Bienenpopulation aufzubauen. Der Staat könnte dann, wenn er die Bienen hierzulande retten wollte, für die Zerstörung von deren Wiese einen so hohen Preis ansetzen, dass das unbezahlbar wird.
Die Kritiker*innen der Wachstumsökonomie würden das Problem anders lösen. Sie würden sagen: Wir müssen unsere Art des Wirtschaftens und des Bewertens grundsätzlich ändern, und wir sollten nicht alles bepreisen. Sie argumentieren, dass es in einer endlichen Welt kein unendliches Wachstum geben kann.
Ich halte diese Diskussion über die Grenzen des Wachstums für eher metaphysisch. Nehmen Sie noch einmal das Klima: Wenn wir unsere Energiesysteme umbauen, dann werden wir saubere Energie fast ohne Ende haben. Also können sie den Klimaschutz durchaus mit einem Wirtschaftsboom und mit mehr Verbrauch an Energie verbinden. Wir müssen dafür allerdings die Infrastruktur um- und ausbauen und die Gebäude energetisch sanieren, in die Wasserstoffwirtschaft einsteigen und auf Elektroautos setzen. Das alles wird dann aber zu einem BIP-Wachstum führen – und die Lebensqualität der Menschen erhöhen.
Auch die Herstellung eines Elektroautos zerstört die Umwelt. Und selbst wenn Sie bei der Energie nicht an die Grenzen des Wachstums stoßen, dann immerhin bei der Frage des Bodens, der Tiere ...
Natürlich brauchen wir überall einen anderen, sparsameren Umgang mit Ressourcen. Natürlich brauchen wir technologischen Fortschritt, der das ökologische Wirtschaften leichter macht. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, also viel mehr Wiederverwertung. Aber bei vielen Rohstoffen sind die Grenzen noch lange nicht erreicht.
Allein in Deutschland vernichten wir jedes Jahr eine Fläche von der Größe Frankfurts – indem wir sie bebauen. Also, wenn das so weitergeht, wird es keine 50 Jahre mehr dauern, bis es in Deutschland kaum noch Wald und Wiese gibt.
Deswegen bin ich auch überzeugt, dass Sie dieses Problem nicht allein dem Markt überlassen können, einfach weil wir Tempo beim Umbau brauchen. Wir wissen durch viele Umfragen, dass die Menschen heute eine hohe Präferenz für Klimaneutralität im Speziellen und für mehr Umweltschutz im Allgemeinen haben. Wir müssen also jetzt noch darüber diskutieren, wie wir den Wandel beschleunigen.
Was schlagen Sie vor?
Im Moment beherrschen zwei eher pessimistische Ideen die Debatte: erstens Verbote, also die Idee, beispielsweise klimaschädliches Verhalten zu bestrafen. Etwa so, wie wir es in der Corona-Krise mit Leuten gemacht haben, die die Ausgangssperren missachtet haben. Sie könnten also Ölheizungen, Eigenheime, Verbrenner verbieten. Allerdings würde so etwas in der Klimakrise auf Dauer schwieriger, weil es um viele Sektoren geht, lange dauern müsste und sehr viele Verbote notwendig machen würde. Die zweite pessimistische Antwort kommt im Moment von vielen Ökonom*innen: einen einheitlichen Preis für CO2 festlegen. Auch durch den soll das klimaschädliche Verhalten im Grunde bestraft werden, weil er vieles teuer machen wird. Ich halte auch das für nur sehr begrenzt sinnvoll.
Warum, das klingt doch herrlich nach Markt?
Weil diese einfache Lehrbuch-Theorie Anpassungskosten nicht berücksichtigt und der CO2-Preis, der die wirklichen Kosten der derzeitigen Umweltzerstörung beinhaltet, sehr viel höher sein müsste als der, den wir heute haben oder auf absehbare Zeit bekommen werden. Hätte er aber die richtige Höhe, dann würde er die Sache enorm ungerecht machen. Der Anwalt könnte sich dann das E-Auto leisten, die Krankenschwester aber nicht, allerdings den Sprit für ihr altes Auto auch nicht mehr. Wir hätten also ein riesiges Verteilungsproblem. Und was machen Sie dann, wenn durch diesen politisch festgesetzten Preis auch noch Arbeitsplätze vernichtet werden?
Warum schauen wir beim Klima immer so auf Gerechtigkeit, wir tun das doch auch in anderen Bereichen nicht, es gibt Kassenpatient*innen und Privatpatient*innen ...
Ich schaue auch in anderen Bereichen auf die Gerechtigkeit. Zudem kann der Arbeitsplatzverlust durch eine hohe CO2-Abgabe direkt auf staatliches Handeln zurückgeführt werden. Und das muss eine Demokratie erst mal verkraften. Ich halte das für eine sehr gefährliche Politik.
Sie könnten diejenigen, die besonders betroffen sind, entschädigen.
Ja, die sogenannten Verlierer*innen werden entschädigt. So etwas können sich nur Menschen einfallen lassen, die sich nicht sehr gut in andere hineinversetzen können. Wer ist schon gern ein*e Verlierer*in? Da verliert jemand seinen Job, bekommt aber einen Klimagutschein von 300 Euro – so schafft man Wutbürger*innen.
Jetzt reden sie nicht mehr wie ein Ökonom, sondern wie ein Politiker.
Ich rede wie der Philosoph Michael Sandel, der sehr gut beschrieben hat, was mit Gesellschaften passiert, in denen zu viele Verlierer*innen produziert werden. Ich rede wie viele Soziolog*innen.
Wir haben am Anfang viel über Preise und ihre Lenkungswirkung gesprochen. Und nun wollen Sie ein entscheidendes Problem wie die Klimakrise nicht über Preise regeln.
Ich möchte, dass wir den politischen Tunnelblick loswerden und mehr über andere Handlungsoptionen reden. Ich würde weniger auf das Bestrafen klimaschädlichen Verhaltens und mehr auf das Belohnen klimafreundlichen Verhaltens setzen. Der Staat sollte daher beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen und noch stärker subventionieren. Er muss die Ladeinfrastruktur für E-Autos ausbauen. Er muss mehr bauen, damit auch ärmere Menschen sich das Wohnen noch leisten können. Er würde so zum Ermöglicher. Wenn er dann noch die vielen klimaschädlichen Subventionen abschaffen würde, würde er so ein klimafreundliches Wachstum ermöglichen. Dann bräuchten wir gar keine hohen CO2-Steuern – denn dann würden zwei große Problembereiche der Klimapolitik umgebaut: der Gebäudesektor und der Verkehr.
Und der Energiesektor?
Auch da ist der Staat gefragt, indem er die nötige Infrastruktur baut oder durch Gesetze ermöglicht. Die Stromleitungen beispielsweise oder die Leitungen für den grünen Wasserstoff – denn der wird jedenfalls zum Teil aus dem Ausland kommen müssen.
Bleibt ein großes Problem in Ihrer Argumentation. In der Vergangenheit hat grünes Wachstum nicht funktioniert, weil mehr Wirtschaftsleistung immer mit mehr Umweltverbrauch verbunden war. Das sogenannte Entkoppeln ist bisher nur eine vage Theorie.
Nur, weil wir das Entkoppeln in der Vergangenheit nicht erreicht haben, bedeutet das nicht, dass es nicht in der Zukunft gehen könnte. Denn es hat sich etwas grundlegend geändert: Klima- und Umweltschutz sind mittlerweile gesellschaftlicher und politischer Konsens. Zudem bedeutet mehr Wachstum nicht automatisch immer mehr Verbrauch. Es ist durchaus ein Konsum vorstellbar, der weniger Ressourcen verbraucht. Wir werden nicht immer mehr Fleisch essen.
Global gesehen passiert genau das.
Aber in Deutschland geht der Konsum eher zurück, und so können sich auch viele andere Konsumgewohnheiten ändern und umweltfreundlicher werden. Und der krisenbedingte Digitalisierungsschub hat bereits viele klimaschädliche Geschäftsreisen überflüssig gemacht. Prinzipiell sehe ich keine Grenzen für ökologisch nachhaltiges Wachstum, solange wir weiterhin erfinderisch bleiben. Die globale Frage ist natürlich sehr komplex, aber in einem bin ich mir sicher: Wenn Deutschland und Europa die ökologische Transformation schaffen, dann wird auch ein globaler Erfolg wahrscheinlicher werden.
Weiterdenken für nachhaltige Zukunftsgestaltung
Wenn wir ökologische und soziale Kosten und Nutzen in ökonomische Bilanzen und Messgrößen miteinbeziehen wollen:
Welche Indikatoren finden inzwischen so breite Unterstützung, dass sie schnellstmöglich standardisiert und gleichwertig neben dem Bruttoinlandsprodukt etabliert werden können? Wie würde sich die betriebliche Bilanzierung von Umwelt- und Sozialkosten auf Preise und damit das Bruttoinlandsprodukt auswirken?
Wenn das übergeordnete Ziel des Wirtschaftens die Lebensqualität der Bürger*innen einer Gesellschaft ist:
Wie wirkt sich das Streben nach immer mehr ökonomischem Output, gemessen im Bruttoinlandsprodukt, in reichen Ländern auf individuelle wie soziale Indikatoren des Wohlergehens und der Lebensqualität aus? Welchen Einfluss haben relative Ungleichheit und gute öffentliche Daseinsvorsorge auf dieses übergeordnete Ziel?
Wenn bei der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts wichtige Informationen fehlen, etwa zu Wohlstandsverteilung, zu Umweltzerstörung und menschlichem Wohlergehen:
Welche Standards oder Regeln können Investitionen und Innovationen so ausrichten, dass sie diese Entwicklungen besser adressieren? Und warum löst die Vorstellung, dass ein qualitativ blindes Bruttoinlandsprodukt stagnieren könnte, dann so eine große Sorge aus? Wie kann dieser Sorge begegnet werden?
Diese und weitere Fragen wollen wir im Rahmen eines öffentlichen Symposiums am 31. August weiter diskutieren. Wenn Sie teilnehmen möchten oder Anregungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail redefiningthepossible@thenew.institute